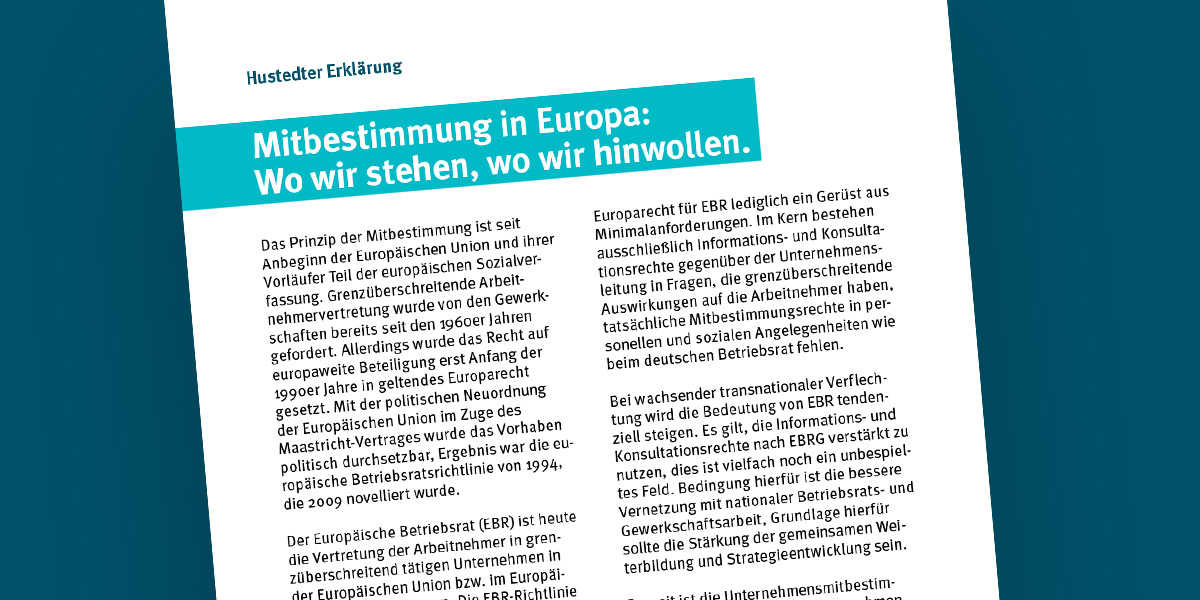
Hustedter Erklärung zur Mitbestimmung in Europa erschienen
Bei der Tagung „Mitbestimmung in Europa: Wo wir stehen, wo wir hinwollen“ wurde die Lage der Mitbestimmung in Europa von Expertinnen und Experten erörtert – mit dabei waren u.a. Wolfgang Lemb (IG Metall), Prof. Klaus Busch, Bernd Lange MdEP, Yasmin Fahimi MdB (Staatssekretärin a.D.) sowie als Teilnehmer/innen u.a. die Mitglieder mehrerer Europäischer Betriebsräte. Zum Abschluss der Tagung wurde dabei von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die „Hustedter Erklärung zur Mitbestimmung in Europa“ beraten.
Download der Hustedter Erklärung als PDF
Hustedter Erklärung
Mitbestimmung in Europa: Wo wir stehen, wo wir hinwollen.
Das Prinzip der Mitbestimmung ist seit Anbeginn der Europäischen Union und ihrer Vorläufer Teil der europäischen Sozialverfassung. Grenzüberschreitende Arbeitnehmervertretung wurde von den Gewerkschaften bereits seit den 1960er Jahren gefordert. Allerdings wurde das Recht auf europaweite Beteiligung erst Anfang der 1990er Jahre in geltendes Europarecht gesetzt. Mit der politischen Neuordnung der Europäischen Union im Zuge des Maastricht-Vertrages wurde das Vorhaben politisch durchsetzbar, Ergebnis war die europäische Betriebsratsrichtlinie von 1994, die 2009 novelliert wurde.
Der Europäische Betriebsrat (EBR) ist heute die Vertretung der Arbeitnehmer in grenzüberschreitend tätigen Unternehmen in der Europäischen Union bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum. Die EBR-Richtlinie regelt allerdings nach wie vor keine einheitliche Verfahrensweise in allen EU-Mitgliedsstaaten – im Ergebnis bleibt es sowohl den nationalen Gesetzgebern, als auch den Unternehmen selbst überlassen, inwieweit die Modalitäten ausgestaltet werden.
Die EU-Richtlinie 2009/38/EG wurde mittlerweile in den EU-Staaten in nationales Recht übertragen, allerdings in sehr unterschiedlicher Weise, z.T. in Einzelgesetzen, z.T. in Ergänzung bestehender Normen. Im deutschen Recht wurde die EU-Richtlinie im Gesetz über Europäische Betriebsräte (EBRG) von 1996 umgesetzt, das 2011 novelliert wurde. Damit sind zumindest die Maßgaben der EU-Richtlinie weitgehend in deutsches Recht umgesetzt.
Durch die historisch unterschiedliche Entwicklung der Mitbestimmung in den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU sichert das Europarecht für EBR lediglich ein Gerüst aus Minimalanforderungen. Im Kern bestehen ausschließlich Informations- und Konsultationsrechte gegenüber der Unternehmensleitung in Fragen, die grenzüberschreitende Auswirkungen auf die Arbeitnehmer haben, tatsächliche Mitbestimmungsrechte in personellen und sozialen Angelegenheiten wie beim deutschen Betriebsrat fehlen.
Bei wachsender transnationaler Verflechtung wird die Bedeutung von EBR tendenziell steigen. Es gilt, die Informations- und Konsultationsrechte nach EBRG verstärkt zu nutzen, dies ist vielfach noch ein unbespieltes Feld. Bedingung hierfür ist die bessere Vernetzung mit nationaler Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit, Grundlage hierfür sollte die Stärkung der gemeinsamen Weiterbildung und Strategieentwicklung sein.
Derzeit ist die Unternehmensmitbestimmung in Europa gefährdet. Unternehmen nutzen zahlreiche Schlupflöcher im geltenden Recht aus, um die Mitbestimmung zu ver- oder behindern. Die EU-Kommission reagiert darauf bisher nicht. Auch für EBR will sie lediglich ein Praxishandbuch veröffentlichen und die geringe Summe von 7 Mio. Euro für die Förderung von EBR in der gesamten EU bereitstellen. Eine Stärkung der Rechte der EBR ist hingegen nicht geplant.
Eingedenk dessen setzen wir uns für mehr Mitbestimmung in Europa und starke Europäische Betriebsräte ein und fordern:
- Rechtsstellung festigen: Die Zuständigkeit und die Rechte von EBR müssen klar definiert werden. Dazu gehört u.a. eine Klarstellung des Begriffs der „länderübergreifenden Zusammenarbeit“, die Grundlage für die Zuständigkeit der EBR ist sowie die rechtssichere Bestimmung des Sitzlandes des Unternehmens.
- Koordination ermöglichen: Betriebsräte auf allen Ebenen müssen sich austauschen und abstimmen können. Hierzu gehört z.B. das uneingeschränkte Zutrittsrecht zu allen Niederlassungen eines Unternehmens.
- Informationsrechte ausbauen: Hierfür ist insbesondere eine verbindliche Liste von Grundinformationen erforderlich, die die Unternehmensleitung dem EBR jeweils vollständig und rechtzeitig für seine Arbeit bereitzustellen hat; diese muss auch
beweispflichtig bei nicht oder verspätet erfolgter Information sein. - Sanktionen verschärfen: Wenn Unternehmensleitungen die Bildung und/oder Tätigkeit von EBR behindern, müssen wirksame Strafen verhängt und durchgesetzt werden können; hierzu gehört zwingend ein einklagbarer Unterlassungsanspruch.
- Arbeitsbedingungen verbessern: Hierzu gehört insbesondere die Einführung von Regeln für die Einberufung und Sitzungsintervalle sowie die Klarstellung der Formalitäten für die EBR-Gremien wie z.B. den Lenkungsausschuss oder im Vorlauf das besondere Verhandlungsgremium. Ebenso müssen die Vertraulichkeitsklauseln für EBR klar gefasst werden (analog BetrVG).
- Weiterbildung absichern: Die bestehenden Fortbildungsrechte für EBR (u.a. nach § 38 EBRG) müssen überall in Europa substanziell ausgebaut sowie rechtlich und materiell abgesichert werden, hierzu gehört die Freistellung unter Lohnfortzahlung und Finanzierung der Weiterbildungsmaßnahmen analog zu § 37 (6) BetrVG.
- Rechtsweg öffnen: EBR sollen als juristische Personen Gerichtsverfahren gegen das Unternehmen führen können. Bisher ist dieses Recht in der Praxis kaum durchführbar, weil u.a. die Bestellung von Rechtsbeständen und/oder Sachverständigen kaum möglich ist; dies muss rechtlich und materiell sichergestellt werden, die Unternehmen müssen die Kosten übernehmen.
- Unternehmensrecht verändern: Die Novellierung des EU-Unternehmensrechts darf nicht zur Gefährdung der Unternehmensmitbestimmung führen, so werden u.a. die europäische Niederlassungsfreiheit, die Möglichkeit zum Wechsel der Rechtsform und Rechtsformen wie SE oder „digitale Unternehmen“ ohne klares Sitzland (Planung gem. „company law package“) können ausgenutzt werden, um die Unternehmensmitbestimmung auszuhebeln. Diese unternehmensrechtlichen Schlupflöcher müssen vollständig geschlossen werden.
- Rahmenrichtlinie für Unternehmensmitbestimmung: Ein allgemeinverbindlicher Rahmen für die Unternehmensmitbestimmung, der überall in Europa gilt, ist dringend nötig. Dabei muss sichergestellt werden, dass bei wachsenden Unternehmen auch die Mitbestimmung mitwächst („Mitbestimmungs-Escalator“).
- Stärkungen der Gewerkschaften in Europa und europäische Wirtschaftsdemokratie: Zentrale politische Forderung bleibt der Ausbau kollektiver Mitbestimmungsrechte und eine wirksame Unternehmensmitbestimmung überall in Europa. EBR dürfen dabei nicht weiter machtlos bleiben, dies gilt ebenfalls für SE-BR. Dafür brauchen wir einen europaweiten gewerkschaftlichen Konsens. In der EU darf nicht die Freiheit des Kapitals Vorrang vor der Arbeit haben. Mitbestimmungsrechte und Betriebsverfassung müssen in gleicher Weise zu ihrem Recht kommen. Die Schutzinteressen der Beschäftigten müssen konsequent vor den Binnenmarktinteressen stehen.